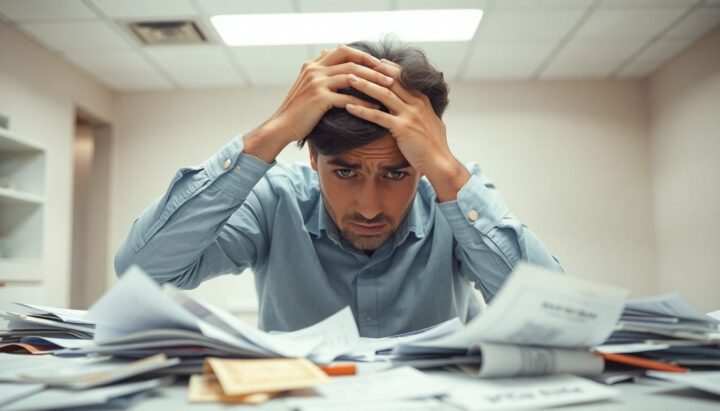Viele Versicherte in der privaten Krankenversicherung (PKV) sehen sich mit steigenden Beiträgen konfrontiert. Doch in solchen Fällen greift ein wichtiges Sonderkündigungsrecht, das Versicherten eine schnelle Reaktion ermöglicht. Dieses Recht ist im Versicherungsvertragsgesetz (VVG) verankert und bietet eine Ausstiegsmöglichkeit, wenn die Versicherung Beiträge erhöht oder Leistungen kürzt.
Wichtige Punkte auf einen Blick
- Ein Sonderkündigungsrecht greift bei Beitragserhöhungen oder Leistungseinschränkungen der PKV.
- Die Kündigungsfrist beträgt zwei Monate nach Erhalt der Änderungsmitteilung.
- Auch bei Einkommensänderungen, die einen Wechsel in die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) erfordern, oder bei Anspruch auf Heilfürsorge besteht ein Sonderkündigungsrecht.
Was ist das Sonderkündigungsrecht?
Das Sonderkündigungsrecht, auch außerordentliche Kündigung genannt, ist in den Paragraphen 205 Abs. 2 und 4 des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) geregelt. Es tritt in Kraft, wenn der private Krankenversicherer die Beiträge anhebt oder die vertraglich vereinbarten Leistungen einschränkt. Ebenso kann es genutzt werden, wenn sich das eigene Einkommen so verändert, dass ein Wechsel in die gesetzliche Krankenversicherung notwendig wird oder wenn ein Anspruch auf Heilfürsorge besteht.
Die private Krankenkasse ist verpflichtet, ihre Mitglieder rechtzeitig über solche Änderungen zu informieren. Nach Erhalt dieser Mitteilung haben Versicherte die Möglichkeit, ihren Vertrag zu kündigen. Bei einer teilweisen Beitragserhöhung, beispielsweise für ein Krankentagegeld, reicht es aus, nur diesen spezifischen Tarif zu kündigen.
Fristen und Vorgehensweise bei der Kündigung
Um das Sonderkündigungsrecht optimal zu nutzen, sollten Versicherte die Fristen und Voraussetzungen genau kennen:
- Beitragserhöhung oder Leistungseinschränkung: Wenn die Versicherung die Beiträge erhöht oder die Leistungen kürzt, kann der Vertrag gekündigt werden. Dies gilt auch für Teilbereiche der Versicherung.
- Wechsel zur gesetzlichen Krankenversicherung: Bei einem geringeren Einkommen, das zur Versicherungspflicht in der GKV führt, oder bei Wechsel in die Familienversicherung kann das Sonderkündigungsrecht greifen.
- Anspruch auf Heilfürsorge: Beamte oder Personen mit Anspruch auf Heilfürsorge können ebenfalls von diesem Recht Gebrauch machen.
Die Kündigungsfrist beträgt zwei Monate ab dem Zeitpunkt, an dem die Änderungsmitteilung des Versicherers empfangen wurde. Die Kündigung wird mit dem Beginn des neuen Beitrags wirksam. Dies bedeutet, dass Versicherte nicht an die regulären Vertragslaufzeiten gebunden sind, um auf eine Beitragserhöhung zu reagieren.
Bei einem Wechsel in die gesetzliche Krankenversicherung aufgrund einer Gehaltsänderung kann die Kündigung rückwirkend bis zu drei Monate nach Eintritt der Versicherungspflicht erfolgen. Die Kündigung muss dann bis zum Monatsende eingereicht werden, an dem der Nachweis der Versicherungspflicht erbracht wird.
So funktioniert die Kündigung in der Praxis
Für eine erfolgreiche Kündigung der PKV sind einige formale Schritte zu beachten:
- Schriftform: Die Kündigung muss schriftlich erfolgen, idealerweise per Einschreiben mit Rückschein oder per Fax mit Sendebericht, um einen Nachweis zu haben.
- Kündigungsgrund angeben: Bei einer außerordentlichen Kündigung ist es wichtig, den Grund klar zu benennen, z.B. „Kündigung wegen Beitragserhöhung“.
- Kündigungsfristen beachten: Das Datum des Eingangs der Kündigung beim Versicherer ist entscheidend für die Fristwahrung.
- Nahtloser Übergang: Um doppelte Beiträge zu vermeiden, muss gleichzeitig ein neuer Versicherungsvertrag abgeschlossen werden. Der Nachweis der neuen Mitgliedschaft muss dem bisherigen Anbieter innerhalb von zwei Monaten nach Kündigungserklärung vorgelegt werden.
Warum steigen die PKV-Beiträge?
Der Verband der Privaten Krankenversicherung (PKV-Verband) begründet die erwarteten Beitragserhöhungen ab 2026 mit gestiegenen Kosten im Gesundheitswesen. Insbesondere die Ausgaben für Krankenhausleistungen, Arzneimittel und Pflegeleistungen sind gestiegen. Auch die Geburtshilfe verteuert sich, und Nachholeffekte aus der Corona-Pandemie führen zu mehr Behandlungen.
Mögliche Nachteile einer Kündigung
Eine Kündigung der PKV sollte gut überlegt sein, da sie auch Nachteile mit sich bringen kann. Dazu gehören eine mögliche erneute Gesundheitsprüfung beim neuen Versicherer, die zu höheren Beiträgen führen kann, der Verlust von Altersrückstellungen und die Tatsache, dass auch neue Verträge Beitragserhöhungen unterliegen können.
Quellen
- Sonderkündigungsrecht PKV Beitragserhöhung – das gilt jetzt, Handelsblatt.